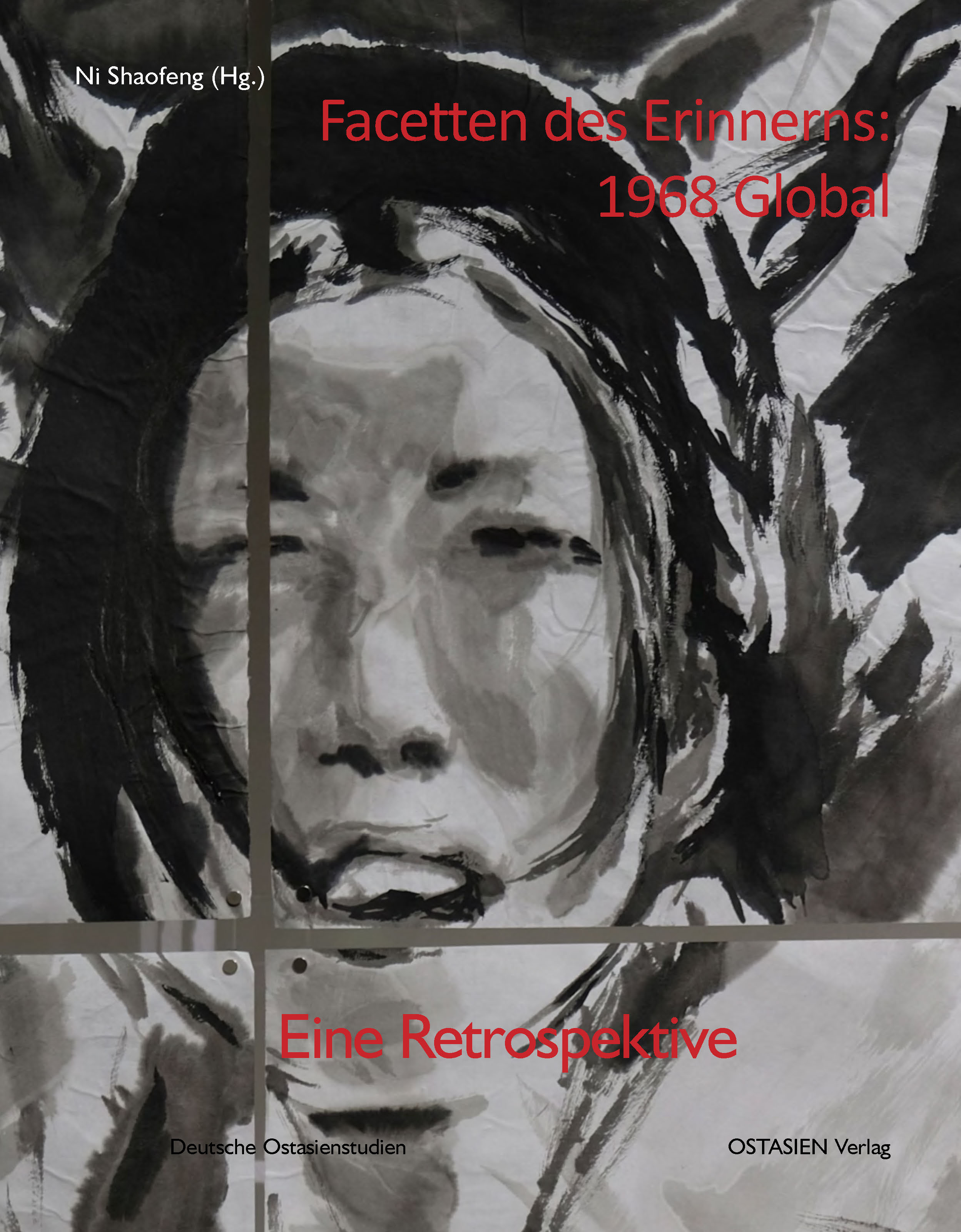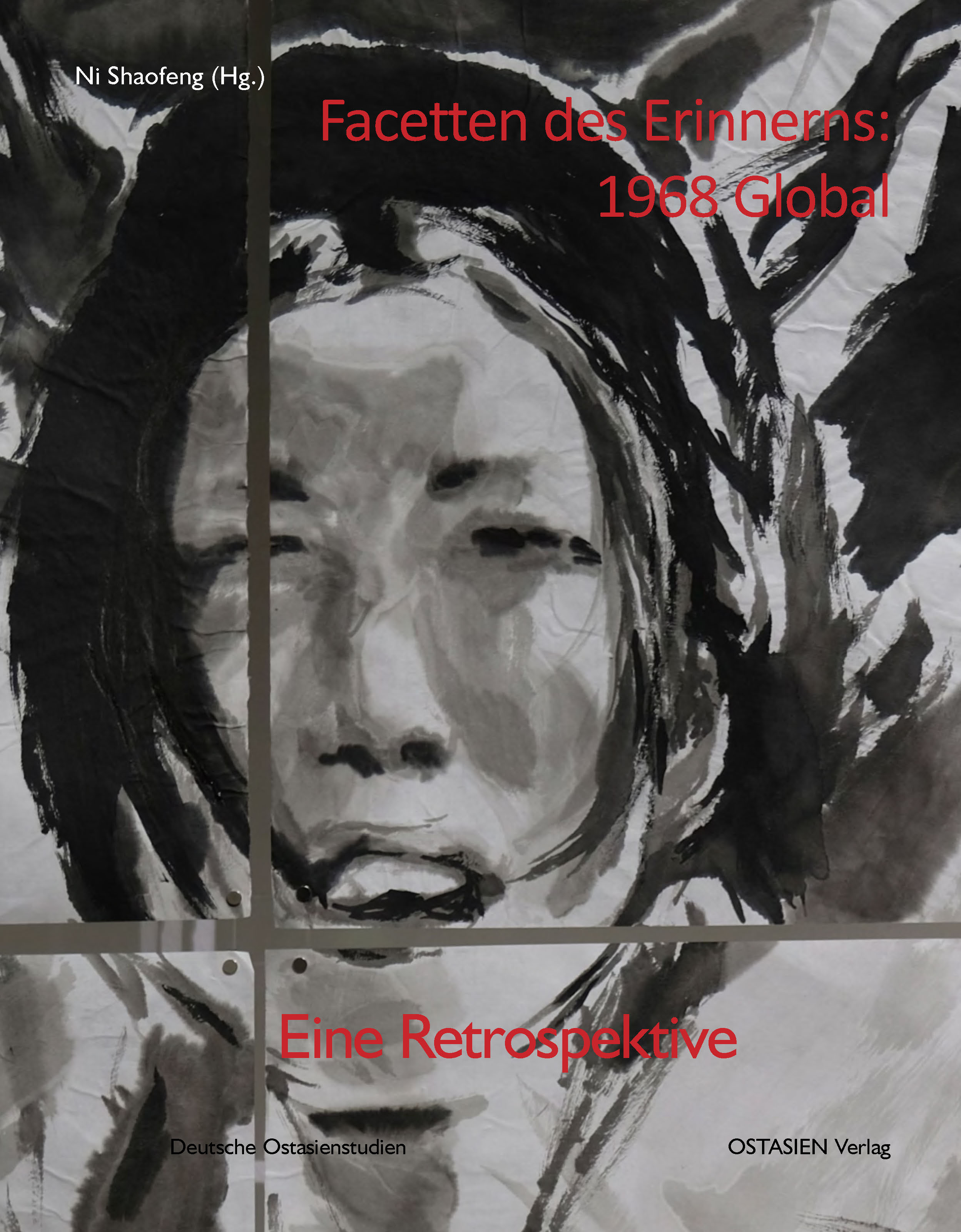Ni Shaofeng und Deng Huaidong, zwei in den frühen 1960er Jahren in China geborene Künstler, setzen sich, ein halbes Jahrhundert nach Ausrufung der sogenannten „Großen Proletarischen Kulturrevolution“ (1966–1976), intensiv mit der visuellen Propaganda jener Zeit auseinander, deren Wirkungen in den 1968er Bewegungen auf der ganzen Welt zu spüren waren.
Die beiden Künstler haben die damals entstandenen Propagandabilder als Basis für ihre eigene Neu- und Uminterpretation verwendet. Ihre Bilder scheinen dem Betrachter zunächst vertraut, stellen sich aber bei genauerer Betrachtung als stark modifiziert heraus. Beide verfolgen einen Ansatz der Verfremdung, den Monika Wagner in ihrem einführenden Beitrag als „Re-Education“ bezeichnet hat. Ni Shaofeng setzt seine Ideen mit traditioneller Tuschetechnik um, mit der er großformatige Gemälde schafft, die jeweils auf fünfzig kleine Rechtecke gemalt sind, die sich wie ein Puzzle zusammensetzen. Deng Huaidong gelingt es durch mehrstufige Verfremdungsverfahren einer differenzierten Bildsprache, den Bildern eine neue Realität zu verleihen.
Die Präsentation der Arbeiten der beiden Künstler ist eingebettet in acht Beiträge von Wissenschaftlern, die sich aus kunsthistorischer, sinologischer und zeitgeschichtlicher Perspektive mit der „Kulturrevolution“, ihrer Propaganda und den Arbeiten der beiden Künstler befassen. |
|
Geleitwort
„Facetten des Erinnerns: 1968 Global – China und die Welt“
Ein halbes Jahrhundert nach dem globalen Aufflammen einer gesellschaftspolitischen Revolte rücken die Ereignisse, die 1968 ihren Höhepunkt fanden, wieder in den Blick. Als aus diesem Anlass das Institut für Sinologie an der Universität Heidelberg mit einer Kooperationsanfrage für ein Ausstellungsprojekt an uns heran trat, haben wir uns sehr über die Möglichkeit gefreut, diese einschneidende und prägende Zeit in der jüngeren Geschichte Chinas und der Welt näher zu beleuchten. Die Thematik der Ausstellung wird durch eine Konzert-, Film- und Vortragsreihe in Kooperation zwischen dem Kino im Karlstorbahnhof, dem Heidelberger Centrum für Asiatische und Transkulturelle Studien CATS und dem Völkerkundemuseum vPST ergänzt und vertieft.
Die Basis der Ausstellung, das Zusammenspiel von Propaganda-Plakaten aus der Zeit der Kulturrevolution (1966–1976) mit Werken des in Hamburg lebenden chinesischen Künstlers Ni Shaofeng bietet die seltene Möglichkeit, einen Dialog zwischen der künstlerischen Binnensicht und einer wissenschaftlichen Perspektive auf die grafische Gattung „politisches Plakat“ zu visualisieren. Dieser Dialog, der in seinem Spannungsfeld neue Perspektiven auf diese einschneidende Epoche ermöglicht, macht das Besondere der Heidelberger Ausstellung aus.
Der Spannungsbogen zwischen den beiden Aspekten, die Intention der Propagandaplakate in ihrer Zeit und die individuelle, sehr persönliche künstlerische Rezeption und Auseinandersetzung mit derselben aus der heutigen Perspektive, räumlich in einen Blick zu rücken, setzt neue Betrachtungsmöglichkeiten frei.
In seinen Bildern greift Ni Shaofeng konkrete politische Bildvorlagen auf, geht in die persönliche Auseinandersetzung mit den damals gängigen Topoi der chinesischen politischen Grafik, setzt diese in eine ausdrucksstarke und beeindruckende Malerei um und kommentiert sie im Werk auf seine ganz eigene, feinsinnige und kritische Weise. Die Malereien bilden dadurch nicht nur visuell einen maximalen Kontrapunkt zur politischen Bildprogrammatik. Er greift die stehenden Topoi dieser Zeitzeugnisse auf und verändert sie, um deren ursprünglich intendierte Wirkung zu brechen und den Betrachter zu irritieren. Seine Werke werden dadurch zu einer zeitgenössischen, kritischen Reflexion der Ereignisse.Wir danken an dieser Stelle Ni Shaofeng, der mit seinem Werk erst die Realisierung dieses Ausstellungsprojekts ermöglicht hat. Dass die Ausstellung durch die Werke von Prof. Deng Huaidong bereichert werden konnten, ist in erster Linie sein Verdienst. Auch Deng Huaidong gebührt unser Dank für die Bereicherung der Ausstellung um eine weitere, künstlerische Perspektive.
Die Propagandaplakate stehen diesen künstlerischen Rezeptionen als historisches Zeitdokument gegenüber. Mit der Kombination aus Bild und Text sind sie aus wissenschaftlicher Perspektive geradezu ein Kondensat der politischen Programmatik ihrer Zeit. Das Institut für Sinologie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg verfügt, vor allem aus privaten Sammlungen, von denen insbesondere die von Peter Köppler und Dietrich Hecht zu nennen sind, über ein beträchtliches Archiv an chinesischen Propagandaplakaten – es umfasst mehr als 2.500 Exemplare. Die Auswahl aus diesem reichen Fundus setzt den Kontrapunkt. Die Bezüge erläutert in ihrem Beitrag und den Erklärungen zu den Exponaten Frau Prof. Dr. Barbara Mittler vom Heidelberger Centrum für Asiatische und Transkuturelle Studien (CATS) als ausgewiesene Expertin für die Phase der Kulturrevolution und der Bildsprache politischer Propaganda. Sie hat die Kooperationsausstellung initiiert und das Projekt federführend gestaltet.
Hanno Lecher, der Leiter der Bereichsbibliothek Ostasien am CATS hat die Erschließung und Verfügbarmachung der Original-Poster aus den 1960er und 1970er Jahren aus den eigenen Beständen ermöglicht und das gemeinsame Projekt begleitet.
Von essentieller Bedeutung für die Realisierung der Ausstellung war auch die unermüdliche Arbeit von Heidi Marweg und Hannes Jedeck am steten Kommunikationsfluss zwischen all den beteiligten Personen und Institutionen, ohne den die Beherrschung der Polyphonie dieses Projekts kaum möglich gewesen wäre.
Es ist uns eine große Freude, dass dieses Ausstellungsprojekt im Völkerkundemuseum der von Portheim-Stiftung (vPST) realisiert werden konnte. Wir danken allen daran Beteiligten für die angenehme und anregende Zusammenarbeit.
Robert Bitsch
Margareta Pavaloi
Völkerkundemuseum vPST, Heidelberg
Juli 2018 |
|
|
Vorwort
Von Hegel stammt die Aussage: „Aus der Geschichte der Völker können wir lernen, dass die Völker aus der Geschichte nichts gelernt haben.“ 2018 jährt sich zum 50. Mal 1968, ein Jahr, das in der Weltgeschichte erinnert wird als ein Jahr der Studentenrevolten, inspiriert von Mao, China und der „Großen Proletarischen Kulturrevolution“ in China. Da stellt sich die Frage, ob wir aus diesem historischen Ereignis etwas gelernt haben. Was wurde von den Wogen der Zeit weggespült, was ist uns geblieben? – Wir, die wir in diesen „Zehn Jahren des Chaos“ schon bewusst gelebt haben, erinnern uns an vieles, das wir mit der „Kulturrevolution“ verbinden. Doch woran genau erinnern wir uns, erinnern wir uns an das tatsächliche Geschehen, oder erinnern wir uns vor allem an das, woran wir uns erinnern sollen, nämlich an das, was uns die Propaganda an zu Erinnerndem aufgegeben hat? Wie viel von dem, was war, haben wir vergessen, wie viel haben wir verdrängt, und wie vieles haben wir in unseren ganz subjektiven Erinnerungen umgestaltet?
Erinnerungen sind stark von Bildern geprägt. Wenn man anfängt, Bilder aus dieser Zeit zusammenzusuchen, so stellt man fest, wie schwer es ist, überhaupt „authentische“ Bilder zu finden, auf die sich Erinnerungen stützen können. Die Bilder, die uns wohl am Markantesten in Erinnerung sind, sind Bilder, die von der offiziellen Propaganda bewusst gestellt und in Umlauf gebracht wurden. Sicher, es gibt auch einige private Bilder – Erinnerungsfotos –, doch auch diese geben nur einen winzigen Ausschnitt von der Wirklichkeit wieder. Unser gesamter Alltag, also auch unser Privatleben, fast alles war damals politisch, alles war gelenkt, fremdbestimmt, indoktriniert, auch der „Rausch“ und die „Begeisterung“ der Massen.
Was können nun, auf der Basis der vorhandenen Bilder, die uns geprägt haben und die auch weiterhin Wirkung auf uns ausüben, wir bildenden Künstler tun? Wir können neue Bilder schaffen, ganz andere, die aus dem Zusammenwirken von Erinnerung und Propaganda entstehen. Können diese Bilder wohl dazu beitragen, eine Erinnerungskultur neu zu begründen?
Ich bin sehr froh, dass sowohl für die erste Ausstellung in Hamburg 2016 als auch für die nun gezeigte Ausstellung 2018 in Heidelberg mein ehemaliger Kommilitone, Prof. Deng Huaidong, bereit war, sich auf dieses gemeinsame Projekt mit mir einzulassen und sich trotz dessen politischer Brisanz mit eigenen Arbeiten daran zu beteiligen. Herr Deng und ich haben uns bei der Umsetzung unseres Konzepts in jeder Phase intensiv miteinander ausgetauscht und abgestimmt. Für seinen Mut und sein Engagement danke ich ihm sehr herzlich. Dank gebührt auch Wang Jinggang, der bei der Entwicklung dieses Kunstprojekts auch ein großes Stück mit uns gegangen ist. Auch Prof. Zhou Luwei hat in der Anfangsphase des Projekts mitgewirkt.
Ein solches Projekt wie das hier gewagte übersteigt bei weitem das, was ich alleine hätte bewerkstelligen können, und ich bin mir dessen bewusst, dass es ohne Hilfe und Unterstützung von vielen unterschiedlichen Seiten niemals hätte zustande kommen können. Hier möchte ich mich gerne an erster Stelle bei Dr. Ernst-Joachim Vierheller dafür bedanken, dass er mir nicht nur in einer frühen Phase, in der sich die Idee zu diesem Projekt herausgebildet hat, vor allem durch seine besondere Fähigkeit, präzise Begriffe zu bilden, „Geburtshilfe“ geleistet hat, sondern mir auch in der Folgezeit immer wieder mit Rat und Zuspruch zur Seite gestanden hat. Erwähnen möchte ich dabei auch Susanne Vierheller, die mich durch ihr eigenes künstlerisches Tun auf sehr schöne Weise bestärken konnte.
Für finanzielle Unterstützung bedanke ich mich bei den Verantwortlichen der Hamburger Kulturbehörde, insbesondere bei Julia Dautel, für die Genehmigung meines Antrags auf finanzielle Förderung meines Projekts. In diesem Zusammenhang danke ich auch Marlis Adjanor, die mir bei der Erledigung der Antragsformalitäten sehr geholfen hat. Von ihr erhoffe ich mir auch weitere Zusammenarbeit in der Zukunft.
Finanzielle Förderung erhielt unser Projekt auch von der Hamburger Sinologischen Gesellschaft (HSG), wobei ich Prof. Dr. Hans Stumpfeldt als dem ehemaligen Vorsitzenden sowohl für materielle als auch ideelle Unterstützung danke und ebenfalls dem jetzigen Vorsitzenden, Prof. Dr. Michael Friedrich, dafür, dass er diese Unterstützung in dessen Sinne fortgeführt hat. Sehr herzlich danke ich auch Prof. Dr. Kai Vogelsang, der das Projekt ermutigt und aus seinen eigenen Mitteln bezuschusst hat.
Ferner danke ich allen, die einen Beitrag zu diesem Katalog verfasst haben – allen voran Prof. Dr. Monika Wagner, die das gesamte Projekt in einen größeren kunstgeschichtlichen Zusammenhang eingebettet und mit ihrer Auslegung auf den Punkt gebracht hat, was Herr Deng und ich künstlerisch angestrebt haben; Herrn Shi Ming, der seine persönlichen Erlebnisse in einen eindrucksvollen Essay einfließen ließ; Herrn Stumpfeldt, der den Katalog um einen sehr persönlichen Beitrag über seine eigenen Erinnerungen an die Zeit der „Kulturrevolution“ in China bereichert hat; Bernd Spyra reflektiert in seinem Text, welche Rolle die Fotografie in der Zeit der „Kulturrevolution“ gespielt hat; PD Dr. Dorothee Schaab-Hanke zeigt in ihrem Beitrag auf der Basis von chinesischen Briefmarken aus der Zeit der „Kulturrevolution“, wie aussagekräftig auch Artikel aus dem Alltagsleben im Hinblick auf die Verbreitung der offiziellen Propaganda – und zwar nicht nur in China, sondern im Ausland – sein können; Prof. Dr. Sebastian Veg ergänzte den Katalog um einen Text, der sich mit der neueren Verarbeitung der Kulturrevolution in China befasst, und für die Heidelberger Ausstellung steuerte Prof. Dr. Barbara Mittler weitere Texte bei.
Ganz besonders dankbar bin ich auch Johannes Barlach, der uns in Hamburg seinen wunderbaren Ausstellungsraum zur Verfügung gestellt hat, ebenso wie für seine Ermutigung und freundliche Unterstützung. Ebenso danken möchte ich auch dem Völkerkundemuseum in Heidelberg und hier vor allem Frau Margarete Pavaloi und Robert Bitsch, die sich so sorgsam um die Ausstellungsgestaltung in Heidelberg gekümmert haben. Sodann danke ich Dr. Olaf Pascheit für die professionellen Fotografien meiner Bilder, ebenso wie Herrn Spyra, der mich ebenfalls fotografisch unterstützt hat. Keineswegs vergessen möchte ich auch den Dank an Frau Prof. Dr. Sarah Kirchberger, die mit sehr viel Empathie und Engagement mein Vorhaben begleitet hat.
Dank auch an meine Studenten, Frau Marie Christine Schierhorn, Herr Jonas Jahnke, Frau Sarah Irina Süßenbacher, Frau Cerise Lai-Magalhaes, Herr Daniel Adlmüller, Frau Leonie Gebhardt, Herr Nils Rohde, die alles Mögliche gemacht haben; ferner danke ich Monika Klaffs und Dr. Ruth Cremerius für deren freundliche Unterstützung. Mein Dank gilt auch Frau Jutta Krüger, die mit großem Engagement und fachlichen Können ein Interview für eine Radiosendung über dieses Kunstprojekt gemacht hat. Ferner möchte ich mich bei Frau Zhang Miao dafür bedanken, dass sie von sich aus ein Video für diese Ausstellung erschaffen hat. Ohne die Offenheit und das Wohlwollen seitens Herrn Dr. Nils Petersen und Frau Diana Mack hätte dieses Kunstprojekts viel schwieriger seinen Anfang genommen.
Besonders sei schließlich auch meinen Verlegern, Dr. Martin Hanke und Dr. Dorothee Schaab-Hanke, gedankt, die beide seit langem meine Freunde sind. Sie haben mir bei der mit viel Arbeit verbundenen Endredaktion und Realisierung dieses neuen, zweiten Katalogs sehr viel Freude gemacht.
Ni Shaofeng
Hamburg, August 2018 |
|
|